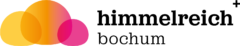Gedanken zum siebten Sonntag der Osterzeit
Wir hängen dazwischen.
So hat Ulrich Schaffer vor Jahren geschrieben.
Ich kenne seine Situation nicht, aber das Gedicht ist für mich bleibend aktuell.
Ob es die Ungewissheit der Kriegssituation in der Ukraine ist, was kommt da noch auf uns zu in Bezug auf Flüchtlinge, wirtschaftlichen Herausforderungen, neuer politischer Ordnung in Europa?
Ob es die Herausforderungen der Energiewende sind, nicht nur die Umrüstung der alten Heizungen?
Ob es die Ankündigung in unserem Bistum zu nur noch 10 Pfarreien insgesamt und damit weiteren Veränderungen in der Pastoral ist?
Ob die immer neuen Missbrauchsstudien noch mehr Menschen aus der Kirche austreten lassen?
Solche Unsicherheiten können zu Resignation und Verzweiflung führen. Solche Umwälzungen fordern wache und veränderungsbereite Zeitgenossen. Und solche Herausforderungen stellen Anfragen an unser Gottvertrauen.
Waren die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten nicht persönlich ähnlich und maximal verunsichert, wie es in ihrer gläubigen Welt weitergehen würde? War die Einladung zum Gottvertrauen damals nicht ähnlich wie die Anfrage an uns heute?
Ihr Ausharren, Hoffen, Glauben kann uns ermutigen, es heute wie sie zu machen. Paulus formuliert die Bitte an die Epheser, ein Wunsch auch für uns:
„Gott erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr immer mehr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch Jesus Christus berufen seid.“ (Epheser 1,18).
Das wünsche ich allen, nicht nur dazwischen, sondern für alle Tage und alle Dinge.
Michael Ludwig
Das Gedicht dazu von Ulrich Schaffer
Wir hängen dazwischen.
Altes ist leer geworden,
es klingt hohl,
bringt nichts mehr zum Schwingen in uns. Worte,
Lieder, Gesten, Bewegungen,
Gedankengebäude,
sie betreffen uns nicht mehr
und darum sind wir nicht betroffen.
Wir warten.
Wir überlegen.
Wir sind unsicher.
Wir ahnen.
Das Neue ist noch nicht da.
Vorsichtig hat es sich angedeutet.
Wir haben es in inneren Bildern gesehen.
Wir wissen, dass es kommen wird,
weil wir das Alte verloren haben.
Es hat noch keinen Namen.
Die alten Worte passen nicht.
Unsere Vorstellungen sind noch zu eng.
Wege sind noch nicht gebahnt.
Wir haben es in Andeutungen gesehen.
Aber wir warten,
Wir überlegen.
Wir sind unsicher.
Wir wissen nur, dass es kommen wird,
weil wir das Alte verloren haben.
Das alte ist leer geworden, es klingt hohl,
bringt nichts mehr zum Schwingen in uns.
Es geschieht etwas an uns
aber nicht in uns.
Müdigkeit ist unser gefährlichster Feind,
und Mutlosigkeit ist unser Begleiter.
Jetzt und hier zu stehen
in diesem Nicht-Mehr und Noch-Nicht,
sich die Lösungen der Vergangenheit
nicht mehr zu genehmigen
ist eine Form von Glauben,
dass alles weitergeht, dass es eine Kraft gibt. die diese Entwicklung steuert,
der ich mich anvertrauen kann.
Ich will mich der Entwicklung nicht entziehen. Ich will loslassen,
um wieder Neues umarmen zu können.
Und auch das will ich wieder loslassen,
in einer Entwicklung auf die Vollkommenheit zu, aus der ich komme und zu der ich gehe.